| Home |
| Weitere Links: |
| |
Claudia S. Leopold
Penetrationsorientierte
Vehikeloptimierung — Pharmakokinetische und pharmakodynamische Aspekte
Institut für Pharmazie, Universität Leipzig
Mit der
Applikation von Wirkstoffen auf die Haut lassen sich verschiedene Ziele verfolgen.
Einerseits kann es erwünscht sein, dass der Wirkstoff auf der Hautoberfläche
verbleibt; andererseits kann die Wirkstoffpenetration in tiefere Hautschichten
bis hin zur Resorption das Ziel sein. Die Wirkstoffpenetration ist durch die Wahl
des Vehikels beeinflussbar. Neben thermodynamischen Effekten, bedingt durch die
unterschiedliche Affinität des Wirkstoffes zu verschiedenen Vehikeln, spielen
hier penetrationsbeschleunigende, d.h. barrieremodifizierende Effekte eine große
Rolle. Solche Effekte können entweder direkt durch Messung des Wirkstofffluxes
in die Haut oder durch Wirkungsmessungen mit Arzneistoffen, die eine quantifizierbare
pharmakodynamische Reaktion hervorrufen, erfasst werden. Bei der Durchführung
der Wirkungsmessungen und der Auswahl der Wirkungsparameter müssen pharmakokinetische
Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt werden, um möglichst genaue
Aussagen zur relativen Bioverfügbarkeit der Zubereitungen treffen zu können
und um zwischen thermodynamischen und penetrationsbeschleunigenden Vehikeleffekten
differenzieren zu können. Verschiedene intensitäts- und zeitbezogene
Wirkungsparameter und die aus simulierten Dosis-Wirkungs-Kurven ermittelten Bioverfügbarkeitsdaten
werden unter Berücksichtigung pharmakokinetischer Gesichtspunkte hinsichtlich
ihrer Aussagekraft beurteilt. Diese Wirkungsparameter sind die reziproke Latenzzeit
LT bis zum Auftreten eines pharmakodynamischen Effektes, die Wirkungsdauer D und
die maximale Wirkung Emax (Abb. 1).
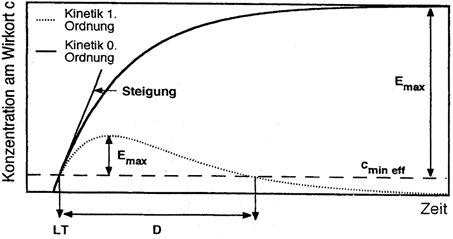
Abb. 1: Simulierte Wirkstoffspiegel
am Wirkort für Penetrationskinetik erster (····)
und nullter (-) Ordnung bei Annahme eines offenen Einkompartimentmodells (Abkürzungen
siehe Text)
Werden Bioverfügbarkeits- und Beschleunigungsfaktoren
f und BF aus Dosis-Wirkungs-Kurven bestimmt, so können zu ihrer Bestimmung
die horizontalen Abstände zwischen parallel verlaufenden Kurven eines Standard-
und einer Testzubereitung sowie die Vertikalquotienten im Bereich der oberen Wirkplateaus
zwischen Test und Standard herangezogen werden (Abb. 2). Während die Horizontalabstände
thermodynamische wie auch penetrationsbeschleunigende Vehikeleffekte beinhalten,
können unterschiedliche Wirkplateaus nur durch barrieremodifizierende Vehikeleffekte
bedingt sein. Aus den Horizontalabständen zwischen parallelen Dosis-Wirkungs-Kurven
lässt sich also der Bioverfügbarkeitsfaktor bestimmen, während
die Vertikalquotienten den Beschleunigungsfaktor darstellen (Abb. 2). Bei penetrationsbeschleunigenden
Vehikeleffekten ist in der Regel durch die unterschiedlichen Wirkplateaus, die
von Standard und Test erreicht werden, mit einem nicht parallelen Kurvenverlauf
zu rechnen. Setzt man die Wirkstoffkonzentration in den Zubereitungen zur jeweiligen
Wirkstofflöslichkeit in den Vehikeln in Beziehung, was der Umrechnung der
Wirkstoffkonzentration in die Wirkstoffaktivität entspricht, so eliminiert
man die thermodynamischen Vehikeleffekte und kann dann aus den Horizontalabständen
der erhaltenen Aktivitäts-Wirkungskurven direkt den Beschleunigungsfaktor
BF bestimmen (Abb. 2).
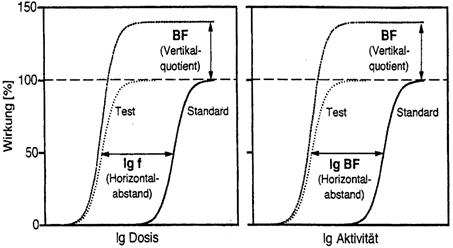
Abb. 2: Bestimmung von
Bioverfügbarkeits- und Beschleunigungsfaktoren aus Dosis- bzw. Aktivitäts-Wirkungskurven
Praktische Relevanz haben diese Ergebnisse, wenn es um die Planung und Durch-
führung von Wirkungsmessungen zur Quantifizierung von Vehikeleffekten oder
zur Beurteilung der Penetrationseigenschaften unterschiedlicher Wirkstoffe geht.
Die Wirkung sollte möglichst schnell, auf einfache Weise (z.B. visuell) und
ohne großen Versuchs- und Zeitaufwand erfaßbar sein. Diese Forderung
wäre bei den Wirkungsparametern maximale Wirkung und reziproke Latenzzeit
gegeben.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass stationäre
Bedingungen garantiert werden sollten, um eine Wirkstoffentleerung, die zu verminderter
Wirkung führt, zu verhindern. Diese Forderung ist mit dem Wirkungsparameter
Wirkungsdauer nicht zu erfüllen. Stationäre Bedingungen können
durch Applikation großer Salbenvolumina über einen gewissen Zeitraum
sowie durch Applikation von Suspensionszubereitungen erreicht werden. Mit Suspensionszubereitungen
lassen sich allerdings keine Dosis-Wirkungs-Kurven aufnehmen. Es handelt sich
hier vielmehr um Einpunktmessungen, durch die nur das obere Wirkplateau einer
Dosis- oder Aktivitäts-Wirkungs-Kurve erfasst werden kann. Aus diesen Plateauwerten
lassen sich dann in Analogie zur Berechnung der Vertikalquotienten aus Dosis-
oder Aktivitäts-Wirkungs-Kurven Beschleunigungsfaktoren bestimmen. Die maximale
Wirkung ist ein geeigneter Parameter für eine solche Bestimmung. Weniger
geeignet für solche Einpunktmessungen ist der Wirkungsparameter reziproke
Latenzzeit, da hier im Beschleunigungsfaktor nur die Beeinflussung des Diffusionskoeffizienten
in der Barriere berücksichtigt wird. Grundsätzlich muss darauf geachtet
werden, dass nach Applikation von Suspensionszubereitungen, die in der Regel zum
maximalen Wirkstoffflux führen, noch nicht die intrinsische Aktivität
des Wirkstoffes (= erreichbarer Maximaleffekt im biologischen System) erreicht
wird, was eine Differenzierung zwischen den Vehikeln unmöglich macht. Eventuell
muss in einem solchen Fall auf einen anderen Modellarzneistoff ausgewichen werden.
Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die maximale Wirkung beeinflusst wird
durch die Schwellenkonzentration am Wirkort cmin eff, die überschritten werden
muss, um eine Wirkung messen zu können (Abb. 1).
Prinzipiell sollten
statt Dosis-Wirkungs-Kurven immer Aktivitäts-Wirkungs-Kurven durch Einsatz
unterschiedlicher Wirkstoffaktivitäten in den Vehikeln aufgenommen werden,
um von vornherein thermodynamische Effekte zu eliminieren und somit penetrationsbeschleunigende
Effekte direkt erfassen zu können. Hier ist bei starker Penetrationsbeschleunigung
allerdings mit nicht-parallelen Kurven zu rechnen, da durch Penetrationsbeschleunigung
entsprechend höhere Wirkplateaus erreicht werden. Die Ermittlung von Beschleunigungsfaktoren
über den Horizontalabstand zwischen Aktivitäts-Wirkungs-Kurven setzt
aber eine Parallelität der Kurven voraus, so dass in diesem Fall die Bestimmung
von Vertikalquotienten im Plateaubereich sinnvoller erscheint.
Diese
Betrachtungen haben direkte Bedeutung für die FDA Guidance for Industry "Topical
dermatologic corticosteroids: In vivo bioequivalence", in der die Durchführung
des Hautabblassungstestes mit Glucocorticoiden über die Messung der maximalen
Wirkung beschrieben wird. In dieser Guidance sollte darauf hingewiesen werden,
dass für eine unverfälschte Quantifizierung von Abblasseffekten stationäre
Bedingungen gewährleistet sein sollten und dass bei der Untersuchung von
Vehikeleffekten die intrinsische Aktivität des Modellwirkstoffes bekannt
sein muss.




Copyright
© 2000 - 2025
Institute for Dermopharmacy GmbH
webmaster@gd-online.de
Haftungsausschluss